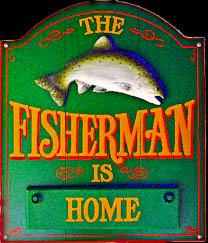Einer der wichtigsten Aufgaben in der Bewirtschaftung unserer Gewässer ist, dass wir lokal angepasste oder noch besser möglichst lokale Fischbestände für die Aufzucht und den Besatz nutzen. Lokale Anpassung bedeutet, dass zwischen einzelnen Populationen, aber auch innerhalb dieser Populationen genetisch bedingte Unterschiede in Körperstruktur, Verhalten oder Stoffwechsel auftreten, die mit spezifischen Umweltbedingungen in einzelnen Gewässerbereichen zusammenhängen. Dabei handelt es sich um über sehr lange Zeiträume gebildete, erblich festgelegte Unterschiede. Neben lokalen Anpassungen, die eine genetische Vielfalt widerspiegeln, zeigen viele Fischarten auch die Fähigkeit, sich bis zu einem gewissen Grad sehr rasch und ohne notwendige genetische Veränderungen auf neue Umweltbedingungen einzustellen. Wobei sich dies durchaus je nach Fischart stark unterscheiden kann, soweit dies unsere Erfahrungen auch bestätigen.

Klassifizierungen unseres Besatzmaterials
Diese Klassifizierung ist eine auf jahrelange Erfahrungen aufbauende Betrachtung und daraus abgeleitete Besatzstrategie. Es stellte sich für uns die Frage, welchen Einfluss die gängige Besatzpraxis auf die genetische Populationsstruktur von Salmoniden im Salzkammergut haben können. Folgende Fragestellungen stehen daher im Fokus unserer Überlegungen:
- Sind die Fische der verschiedenen Fischzuchtbetriebe mit denen wir unsere Gewässer besetzen, miteinander verwandt?
- Gibt es in den Seitenbächen Subpopulationen?
- Sind die Äschen der Goiserer Traun genetisch mit den Äschen in der Ischl verwandt?
- Sind Bachforellen genetisch unterscheidbar und somit genetisch differenzierte Populationen, zwischen den Tälern und Bächen?
Daher haben wir für die Entwicklung für unser Besatzmaterial folgende Klassifizierung für unsere fischereiliche Planung von Besatzmaßnahmen, die möglichst auf die heimischen Wildbestände von Salmoniden lt. Fischarten-Liste angewendet werden:
Diese Empfehlungen ist in der angegebenen Reihenfolge zu priorisieren, grundsätzlich gilt:
Besatzmaterial soll nur aus unserem Gewässersystem abstammen.
Definition
Die praktische Durchführung unser Wildkultur-Fisch-Entwicklung erfordert eine klare Definition der Begriffe: “autochthon, heimisch und bodenständig”.
Zum Beispiel:
- ursprünglich aus demselben Gewässersystem
- oder aus dem Großeinzugsgebiet stammend,
- oder auf einen kleineren isolierten Gewässerabschnitt
- oder einen See innerhalb dieses Gewässersystems bezogen.
Zur Beurteilung der Herkunft stellt die Erfassung möglichst weit zurückreichender geschichtlicher Informationen über Fischarten und Bewirtschaftung eine gute Basis dar.

Eine erste Einteilung – Version 1.0
In einer ersten Version „heimisch“ soll heißen, ursprünglich zumindest aus dem selben Gewässersystem stammend. Genetisch einwandfrei soll heißen, heimisch, arttypischer Größenwuchs, arttypisches Verhalten und Funktion im Gewässer, wie Standorttreue bei der Bachforelle und volle Reproduktionsfähigkeit bei der Äsche und der Regenbogenforelle. Besatzfische müssen auch physiologisch intakt sein, das heißt gesund, frei von Parasiten und mit weitestgehend natürlicher Ausbildung von Haut, Zeichnung, Kiemen und vor allem Flossen.
Für Besatzfische gelten wesentlich höhere Standards als für Speisefische.
Dies rechtfertigt auch einen höheren Preis.

Einer der schwerwiegendsten und besorgniserregendsten Verstöße gegen den erhalt unserer Wildkultur-Fischpopulationen, ist das weitverbreitete Verirren und Besetzen von Zuchtfischen in unsere Gewässer.
Dies geschieht, wenn in Zuchtbetrieben gezüchtete Fische, die als Lebensmittel bestimmt sind, in unsere Seen, Bäche und Flüsse ausgesetzt werden, wo sie sich mit Wildfischen vermehren. Wenn dies in einem Ausmaß geschieht, das das ein Maß überschreitet, untergraben Speisefische die Genetik der Wildfische, die sich mit Wildfischen vermehren, stellen erhebliche Herausforderungen für die Erholung unserer vom Aussterben bedrohten Wildfischpopulationen dar. Daher ist unser Schwerpunkt, wenn Besatz erforderlich und Sinnvoll ist, diesen NUR mit lokal angepassten Fischen durchzuführen.
Wildkultur-Fisch-Entwicklung

Der Begriff „Wildkultur“ betont die Bedeutung der Anpassung der Fische an ihre natürliche Umgebung. Durch die Verwendung von natürlich vorkommenden Beständen wird sichergestellt, dass die Fische optimal an die lokalen Bedingungen angepasst sind. Die genetische Vielfalt ist ein wichtiger Faktor für die Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit von Fischbeständen. Durch die Erhaltung lokaler Salmoniden Stämme wollen wir dazu beitragen, die genetische Vielfalt dieser Arten zu fördern und zu erhalten.

Unterschiede je nach Fischart
Äsche

Die Äsche (Thymallus thymallus) wird oft als „Mimose unter den Salmoniden“ bezeichnet, und das aus gutem Grund. Ihre Zucht gilt als besonders anspruchsvoll und schwierig. Hier sind einige Gründe dafür:

1. Hohe Ansprüche an die Wasserqualität: Äschen benötigen sehr sauberes, sauerstoffreiches und kühles Wasser. Bereits geringe Verschmutzungen oder Temperaturabweichungen können zu Stress oder sogar zum Tod der Fische führen.

2. Spezielle Nahrungsbedürfnisse: Äschen sind sehr wählerisch bei ihrer Nahrung. Sie bevorzugen lebende Insekten, Krebstiere und andere Kleintiere. In der Zucht ist es schwierig, diese natürliche Nahrung adäquat zu ersetzen.

3. Langsame Entwicklung: Äschen wachsen relativ langsam und erreichen erst nach mehreren Jahren die Geschlechtsreife. Dies macht die Zucht langwierig und kostenintensiv.
4. Empfindlichkeit gegenüber Stress: Äschen reagieren sehr empfindlich auf Stress, sei es durch Transport, Handling, Wassertemperatur oder Veränderungen in ihrer Umgebung. Stress kann zu Krankheiten oder zum Ausbleiben der Fortpflanzung führen.
5. Schwierige Fortpflanzung: Die Fortpflanzung von Äschen in Gefangenschaft ist eine Herausforderung. Die Weibchen legen ihre Eier nur an bestimmten Stellen ab, und die Befruchtung muss unter optimalen Bedingungen erfolgen. Daher arbeiten wir bei der Äsche zu 100% mit in der Natur abgefischten Elterntieren, die an Ort und Stelle abgestreift und in ihr Heimatgewässer zurückgesetzt werden. Die gewonnen Eier entwickeln wir in der geschützten Umgebung in unseren Bruthaus.

Bachforelle
Die Bachforelle (Salmo trutta) ist eine der bekanntesten und beliebtesten Fischarten im Salzkammergut. Sie ist die Leitart der sogenannten Forellenregion und sie braucht Gewässer mit klaren, sauerstoffreiches Wasser und im Sommer eine Wasser-Temperatur, die 15°C nicht über längere Zeit übersteigt.
Anthropogen beeinflusst
Durch über 160 Jahre Fischzucht im Salzkammergut, ist gerade die Bachforelle vom Menschen stark beeinflusste und durch menschliche Einwirkung anthropogen überzüchtet worden.
Das Aufspüren alter heimischer Bachforellenlinien und ihre Wiedereinbürgerung in ausgewählte Gewässer ist Gegenstand des „Projekt Leopold“. Vom „Fischereimanagement Salzkammergut“ (FMSKG) arbeitete dabei mit in der Region vorkommenden Bachforellenlinien – auch wenn die Bachforelle (derzeit) auf keiner „roten Liste“ gefährdeter Arten steht, ist sie dennoch vom Aussterben bedroht, weil ihr Lebensraum durch den Klimawandel stark dezimiert wird.
Punktesystem bei Bachforellen
Bei den über 50 Jahre dauernden Freilandbeobachtungen konnten ich bei Bachforellen durchwegs
unterschiedliche Farbgebung und Varianten in allen untersuchten Gebieten festgestellt werden. Der Schluss liegt nahe, dass Bachforellen durchwegs individuelle Farbgebungen anstreben. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommen auch Lahnsteiner et al. (2003): »Die Färbung und Zeichnung von Bachforellen variierte innerhalb jeder Population beträchtlich, da praktisch alle möglichen Farbvariationen vorkommen können. Dies macht die Farbparameter als diagnostisches Mittel ungeeignet.«


Bei Bachforellen konnten Dunkelfärbungen des ganzen Fischkörpers beobachtet werden. Weiters wurde die Schwarzfärbung nur einer Seite des Fischkörpers und zum Dritten »Leopardenmuster«-gefleckte Körperstellen des Fisches beobachtet. Die artspezifischen Färbungselemente (rote Punkte) sind weiterhin erkennbar.

Detailbeobachtungen
Daher kommt den Detailbeobachtungen im Freiland von einzelnen Tieren unter Berücksichtigung ihres unmittelbaren Lebensraumes besondere Bedeutung zu. Äußere Einflüsse, insbesondere kurzfristiger Art, sind von Interesse, ebenso wie die Altersklasse der jeweiligen Fische. Auch können wir je nach Bach, unterschiede im Termin der Laichzeit und der Ei Größe feststellen. Bei der Laichzeit bewegen wir uns je nach „Stamm“, zwischen Mitte November bis Ende Jänner. D.h. da reden wir Unterschieden im Abstreiftermin von 75 Tagen. Eine ähnliche Spreizung sind auch bei den Regenbogenforellen zu beobachten.
Veränderung der Bestände
Die Bachforelle war bis ca. 1995 auch der Leitfisch an der Oberen Traun mit einen Anteil von >80% an der Fischbiomaße. Leider ist dieser in den letzten 30 Jahren durch PKD Komplet verschwunden.


160 Jahre Bachforellen Zucht
Die Bachforellenpopulationen im Salzkammergut werden seit 160 Jahren durch gezielte Fischzucht und Besatzmassnahmen mit Fischen aus verschiedensten Quellen besetzt. Der Fisch-Besatz obliegt der
Koordination des jeweiligen Fischereirechtsinhaber bzw. dessen Pächter. Damit wurden auch viele unterschiedliche Bachforellen-Gene in den Bächen im Salzkammergut ausgesetzt und es haben sich unterschiedliche Stämme etabliert und behauptet. In weiterer Folge wollen wir mittels der genetischen Charakterisierung der am geeignetsten Bachforelle, unser Bestandsmanagements mit wissenschaftlich fundierter Begleitung fördern.

Seit 2019 sind wir bemüht, mit Elterntiere der für den jährlichen Besatz Eier und Brütlinge, mit lokalstämmigen Bachforellen in unserer Wildkultur-Fisch-Entwicklung aus den der Traun zufließenden Seitenbächen zu verwenden. Sie werden per Elektrobefischung gefangen, kurzzeitig gehältert, abgestreift und danach wieder ins Ursprungsgewässer zurückgesetzt. Das Ausbrüten der Eier erfolgt dann in unseren Bruthaus welches wir für die Wildkultur-Fisch-Entwicklung vom Fischereimanagement Salzkammergut (FMSKG) in Ebensee und im neuen FischLab in Altmünster, betreiben. Im FMSKG brütet wir pro Jahr im Durchschnitt rund 150.000 Bachforellen Eier aus und bringen die in den unterschiedlichen Stadien wieder in unsere Gewässer aus.

Anthropogene Bestände

Bei der Bachforelle ist davon auszugehen, dass die natürlichen populationsgenetischen Strukturen in Ihrer Bestände anthropogen über formt sind. Informationen über das historische und aktuelle Management
unserer Bestände werden wir bei den künftigen Beprobungen feststellen und daraus unsere Schlüsse ziehen. Da wir jedoch mit der Bachforelle eine Art haben, bei dir eine besonders hohen genetischen Diversität vorliegt, stellt sich die Frage, ob es nicht ausreichend ist sich auf unsere lokalstämmige, bei uns etalierte und ablaichende Bestände zu fokussieren.
Wenn sie sich wohl fühlen und vermehren ist auch unser Hauptziel erreicht, selbst reproduzierende Bestände in unseren Gewässern zu haben und mit begleitenden Renaturierungsmaßnahmen, Laichplätze, Jungfisch-Habitate und genügend Strukturen für Adulte Fische zu haben und eingebaut zu bekommen, damit unsere Fischbestände ohne zutun sich erhalten können.
Bekannte Bachforellen-Stämme

Gravierende anthropogene Eingriffe in die Fließgewässer haben den Lebensraum der Fische massiv beeinträchtigt und führten vielerorts zum Rückgang der Fischbestände. Durch intensive Besatzmaßnahmen mit Atlantikstämmigen Bachforellen, die man seit den 1940er – 1950er Jahren über Fischzuchtbetriebe leicht beziehen konnte, versuchte und versucht man heute noch Bestandsdefizite bis hin in entlegenste Gebiete auszugleichen. Diese jahrzehntelange Praktik einer Einmischung fremder Gene in die lokalen Linien führten zum Verschwinden der Donaustämmigen Bachforelle. Sehr lange war man sich über die Folgen dieser Besatzmaßnahmen mit genetisch fremden Bachforellen nicht bewusst.
Eine großräumige phylogenetische Analyse der Bachforelle über weite Teile ihres Verbreitungsgebietes mittels DNA-Sequenzierung legten Bernatchez et al. (1992) vor. Hier wurden fünf verschiedene Gruppen identifiziert. Nach weiterführenden Arbeiten (Bernatchez & Osinov 1995; Bernatchez 2001) wurden vier dieser Gruppen entsprechend ihrer wesentlichen geographischen Verbreitung als
- atlantische,
- danubische,
- adriatische und
- mediterrane
Linie bezeichnet. Die fünfte Gruppe wurde nach der sogenannten Marmorierten Forelle, einem besonderen Phänotypen aus dem Gebiet etwa zwischen dem Po in Italien und der Soča in Slowenien, als Marmoratus-Linie benannt. Diese Bezeichnungen finden bis heute häufig Anwendung.
Donaustämmigen Bachforelle

Die Donaustämmige Bachforelle hat sich über Jahrtausende an die klimatischen Verhältnisse in den Alpen, im Besonderen an jahreszeitliche Abflüsse und Temperaturen in unseren Gebirgsbächen angepasst. Sie ist ein außerordentlich standorttreuer Fisch, der geschützte Einstände in dynamischen, kalten Gebirgsbächen liebt und extreme Hochwasserereignisse gut übersteht.

Der ursprüngliche Lebensraum der Donaustämmigen Bachforelle sind alle Fließgewässer, die in die Donau münden. In Vorarlberg gehören die Bachforellen, die aus dem Rhein Einzugsgebiet stammen, zum Atlantik Typ. Alle übrigen Gewässer Österreichs münden in die Donau, in denen entwicklungsgeschichtlich die Donaustämmige Bachforelle leben müsste. Heute kommen allerdings nur noch Atlantikstämmige Bachforellen vor.
Neuere Studien zeigen, dass die Evolutionsgeschichte der Bachforelle jedoch wesentlich komplexer ist als von Bernatchez (2001) vorgeschlagen wurde. Um dieser komplexen Situation im Hinblick auf den Schutz der innerartlichen Diversität der Bachforelle und im Hinblick auf ein angemessenes fischereiliches Management gerecht zu werden, werden wir ein Sample an DNA Proben über unsere Wildkultur-Bachforellen bei Seven Weiss an der UNI Graz untersuchen lassen.
Forellen für Wiederbesatzmaßnahmen
Die derzeit in Fischzuchtbetrieben vorhandenen und für Wiederbesatzmaßnahmen eingesetzten Forellen sind nur bedingt geeignet, da sie im Vergleich zu den in den aufnehmenden Gewässern beprobten Forellen ziemlich deutliche Unterschiede aufweisen. Daher wollen wir, um Wiederansiedlungs-Projekte zu verbessern, logistische und Managementmaßnahmen ergreifen, insbesondere soll der Bestand an „danubischen Bachforellen“ oder noch besser, „danubische-traunstämmige Bachforellen“ in unserer Wildkultur-Fisch-Entwicklung ein Schwerpunkt in den nächsten Jahren gelegt werden. Gleichzeitig wollen wir neue Wiederbesiedlungsstrategien entwickelt, um die natürliche Fortpflanzung in den Gewässern zu fördern. Das „Projekt Leopold“ wird uns die nächsten Jahre beschäftigen.
Seeforelle
Auch hier verfolgen wir den Plan, die Erhaltung von unseren lokalen Seeforellenstämme zu fördern und sind auf der Suche nach lokalstämmigen Traunsee-, Hallstättersee- oder Wolfgangsee – Seeforellen.

Die Problematik der Vermischung verschiedener Seeforellenbestände ist ähnlich der Bachforelle und unterstreicht die Bedeutung unseres Wildkultur-Fisch-Entwicklung-Ansatzes.

Hier einige Punkte und Überlegungen zu unserem Vorhaben
- Bestandsaufnahme und genetische Analyse: Bevor wir mit der Zucht beginnen, ist eine gründliche Recherche der noch vorhandenen lokalen Seeforellenstämme unerlässlich. Eine genetische Analyse soll uns dabei helfen, die Bestände zu identifizieren. Dies ist wichtig, um die am besten geeigneten Elterntiere für die Zucht auszuwählen und eine weitere Vermischung der Bestände zu vermeiden.
- Auswahl der Elterntiere: Wir wollen nur gesunde und genetisch vielfältige Elterntiere, die aus den lokalen Wild-Beständen stammen verwenden.
- Zuchtbedingungen: Optimale Bedingungen für die Aufzucht der Seeforellen haben wir in unseren Bruthäusern und eine Elterntierhaltung ist derzeit nicht geplant.
- Aufzucht der Jungfische: Die Aufzucht der Jungfische sollte in einer naturnahen Umgebung erfolgen, die den natürlichen Lebensbedingungen der Seeforellen entspricht. Dies können wir beispielsweise durch die Schaffung von geeigneten Unterständen in unseren Becken erreichen.
- Besatzmaßnahmen: Wir setzen den den Seeforellen-Nachwuchs in geeigneten Gewässern aus, in denen sie sich natürlich fortpflanzen können und wir achten darauf, dass die Besatzmaßnahmen nicht zu einer weiteren Vermischung der Bestände führen.
- Monitoring: Eine Überwachen über die Entwicklung der Seeforellenbestände nach den Besatzmaßnahmen, um den Erfolg der Zucht zu überprüfen und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen ist bei uns obligatorisch.
- Zusammenarbeit: Wir Arbeiten eng mit Forschungseinrichtungen und Bewirtschaftern zusammen, um unser Wissen und Erfahrungen auszutauschen und die Schutzbemühungen für die Seeforellen zu optimieren.

Regenbogenforelle

Die Entwicklung einer Wildkultur-Fisch-Entwicklung für lokalstämmige, bei uns etablierte und ablaichende Regenbogenforellen (RBF) unter Berücksichtigung der natürlich vorkommenden Bestände ist ein vielversprechender Weg, um die Gesundheit und Vielfalt dieser Fischart in unseren Gewässern, wenn erforderlich zu fördern.


Auch bei den RBF werden wir Proben entnehmen, für eine genetische Analyse, um die verschiedenen RBF-Bestände zu identifizieren und ihre genetische Vielfalt zu bestimmen. Dies kann entscheidend sein, um die am besten geeigneten Elterntiere für die Zucht auszuwählen. Vor allem geht es uns darum, dass die Besatzmaßnahmen nicht zu einer weiteren Vermischung der Bestände führen.

Bestandsmanagement: Ein erfolgreiches Bestandsmanagement von Regenbogenforellen erfordert eine langfristige Planung und eine Integration in unsere Wildkultur-Fisch-Entwicklung. da wir eine sehr gute eigen Reproduktion bei den Regenbogenforellen haben, halten sich unsere Aktivitäten in Grenzen. Jedoch wichtig ist, dass wir wissen, an welchen Schräubchen wir drehen können, wenn wir den Bestand der RBF unterstützen und fördern müssten.
Weitere Fischarten
Die Berücksichtigung von Nebenfischarten wie Elritze und Koppe, insbesondere da diese teilweise unter der FFH-Richtlinie geschützt sind und deren Bestände abnehmen, ist ein wichtiger Beitrag zum Artenschutz und zur Erhaltung der Biodiversität in unseren Gewässern. Die Zucht dieser Arten kann eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung und Wiederherstellung ihrer Populationen spielen.

Anpassungen an den Lebensraum
So wie sich Forellen an die Bedingungen in ihrem natürlichen Lebensraum anpassen, passen sie sich auch genetisch und phänotypisch (Körperbau, Verhalten, Physiologie) an die in der Fischzucht herrschenden Bedingungen an. Im Vergleich zum natürlichen Lebensraum sind die Umweltbedingungen in Zuchtbetrieben jedoch äußerst homogen. Es fehlt das heterogene Gefüge aus Abfluss, Gefälle, Tiefen-, Breiten- und Strömungsvariabilität, das komplexe und den Lebensraum auszeichnende Strukturangebot,
die von Tages-, Jahreszeiten und Standort geprägte Verfügbarkeit von Nahrung und schließlich die durch eine Vielzahl unterschiedlicher Prädatoren geprägte Erkennung von Gefahrensituationen.

Unser Bewirtschaftungskonzepte ist gewässerspezifisch, revierüberschreitend und vor allem praktikabel. Neben den direkten fischereilichen Maßnahmen soll dieses Konzepte auch bestmögliche Strukturverbesserungen der Gewässer enthalten, wie:
- Rückbau,
- Restrukturierung
- Laichplatzverbesserungen
- Schaffung von Jungfischhabitaten
- Strukturen für Fischeinstände
- Totholz-Einbauten
- Ufersaum
- Durchgängigkeit
- und genügend Wasserführung.
Für die Erarbeitung und Umsetzung ist die enge Zusammenarbeit zwischen Behörden, Fischereibiologen und Gewässerbewirtschaftern unbedingt erforderlich. Aktuelle, qualitative und quantitative Kenntnisse des Fischbestandes bezüglich Arten, Herkunft, Bestandsdichten und Populationsaufbau sind erforderlich um den Bedarf nach Fischbesatz zu beurteilen. Dies erfordert eine fischökologische Bestandserhebung mit Informationen über die Bestandsentwicklung in der Vergangenheit (Geschichte, Statistik). Beprobungen von heimischen, genetisch einwandfreien Besatzfischen für den Wiederaufbau, zur Erhaltung und Regulierung von Beständen per DNA Analysen kann helfen, wichtiger ist jedoch, von etablierten, selbst reproduzierenden Wildfischbeständen den Nachwuchs weiter zu fördern.

Genetische Vielfalt ist Überlebens wichtig
Im Zuge von Klimawandel und Lebensraumverlust ist eine hohe Anpassungsfähigkeit für viele Arten Überlebens wichtig, da sich die Umweltbedingungen ständig verändern. Ist die genetische Vielfalt innerhalb einer Art sehr hoch, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass eine dieser Genvarianten in den neuen Umweltbedingungen von Vorteil ist. Ein Träger einer solchen Genvariante hat zum Beispiel eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit oder mehr Erfolg in der Fortpflanzung, so dass sich die Variante innerhalb der Art ausbreiten kann und sich die Anpassung der gesamten Art an die neuen Umweltbedingungen verbessert.
Bedeutung der genetischen Vielfalt
Zwischen den Einzugsgebieten Donau und Rhein gibt es im Hinblick auf die Fischartengemeinschaften erhebliche besiedlungsgeschichtliche und zoogeografische Unterschiede. Nicht nur einzelne Arten sind für Flusssysteme endemisch, innerhalb vieler Arten gibt es klare zoogeographische Unterschiede zwischen einzelnen Einzugsgebieten. Ein Beispiel dafür ist die Bachforelle (Salmo trutta), die sich in den Einzugsgebieten von Rhein und Donau Populationen entwickelt hat, die sich mit genetischen Methoden klar unterscheiden lassen. Anhand dieser Erkenntnisse lassen sich geeignete Maßnahmen zur nachhaltigen Nutzung ableiten, die als Grundlage für die Aufrechterhaltung der genetischen Vielfalt der betreffenden Arten dienen können
Bei der Äsche mussten wir durch gescheiterte Besatzversuche die Erfahrung sammeln, dass quasi Nachbar Populationen aus anderen Regionen zur Auf-Mischung der Traun-Äschen zu weit entfernt liegt, daher konnte hier kein Austausch stattfinden. Andere Fischarten sind kompatibler und es findet rascher ein Austausch von Genen statt, der ev. auch künftig wichtige Vorteile für die jeweilige Art bieten kann.
Unser Weg
Biodiversität ist mehr als nur die Vielfalt der Arten. Ein weiterer wichtiger Aspekt von Biodiversität ist die genetische Vielfalt innerhalb der jeweiligen Arten. Die innerartliche genetische Vielfalt repräsentiert die Anpassung z.B. von Fischarten wie der Bachforelle, an unterschiedliche regionale Umweltbedingungen. Sie stellt auch die Basis dafür dar, dass Arten auf eine sich verändernde Umwelt reagieren und aus einem Lebensraum verschwinden, bis sich ev. ein Population entwickelt, die mit den veränderten Lebensbedingungen zu recht kommt, oder eben auch nicht. Dann wird der Platz von einer anderen Art, wie z.B. der Regenbogenforelle eingenommen.
Erfassung und Dokumentation der genetischen Vielfalt
Als Grundvoraussetzung zur Sicherung und nachhaltigen Nutzung der aquatischen genetischen Ressourcen ist die Erhebung und Dokumentation der genetischen Charakteristika von unseren Wildfischbeständen unerlässlich. Nur wenn die genetische Vielfalt innerhalb einer Art bekannt ist, kann sie auch gezielt bewahrt werden. Deshalb versuchen wir im Rahmen der Umsetzung unserer Projekte auch eine umfassende populationsgenetische Charakterisierungen unserer Wildbeständen im Salzkammergut, zu erheben.
Welche Alternativen zum klassischen Fischbesatz bleiben einen Bewirtschafter?

Turnaround
Der Turnaround in der Bewirtschaftung unserer Gewässer ist erreicht, wenn wir einen Wendepunkt in der natürlichen Reproduktion erreicht haben und der Lebensraum ausreichend ist, dann wächst jedes Jahr soviel zu, das man mäßig und bescheiden Wildfische entnehmen kann, wenn man will. Im allgemeineren Sinn und als Maßzahl wird eine grundlegende Verbesserung der Fischbiomaße als Turnaround bezeichnet, speziell in Verbindung mit Renaturierungsprojekten mit Laichplatzverbesserungen, Jungfischhabitaten und Strukturverbesserungsmaßnahmen für adulte Fische, die Prädatoren Bestände angepasst werden und auch die Befischung sich an den Möglichkeiten unsere Gewässer regelt. Für unser Fischbesatzmanagement empfiehlt sich das Grundprinzip der lernfähigen Hege, bestehend aus:
- der Entscheidung, dass von den Bewirtschaftern im FROSKG die Gründung des Verein „Fischereimanagement Salzkammergut“ (FMSKG) im Jahr 2019 beschlossen wurde, bei dem jeder Bewirtschafter Mitglied ist und damit die Services vom FMSKG nutzen kann.
- Die Alternative zu Speisefisch-Besatz ist, dass ein jährlicher Laichfischfang von lokalen Elterntieren durchgeführt wird, um zu vermeiden, dass Mutterfischstämme über Generationen in der Fischzucht gehalten werden.
- Eine weitere Empfehlung besteht darin, Besatzfische möglichst kurz in der Zucht zu halten, also möglichst rasch nach der Befruchtung der Eier zu besetzen, um die ungewollten evolutionären Veränderungen in der Zucht zu minimieren.

- Wenn Eier oder Jungfische früh in ihre natürliche Umgebung gebracht werden, kann die Abnahme des Reproduktionserfolges der Besatzfische zumindest teilweise verhindert werden.

Salmoniden gehören zu den sozioökonomisch wertvollsten Fischen und sind die am häufigsten mit in Brutanstalten aufgezogenen Fischarten. Hier nutzten wir eine molekulare Abstammungsanalyse und sammeln auch DNA Proben, um den Reproduktionserfolg von in der Wildnis bzw. genetisch in unserer Region geborenen Elterntiere zu beurteilen und mit diesen eine Wiederbesetzung unserer Gewässer zu fördern.

In der Tat ist es besser, auf einen Fischbesatz in natürlichen Gewässern zu verzichten, als einen falschen oder unpassenden Besatz durchzuführen. Dies gilt insbesondere für den Besatz mit Speisefischen, die nicht heimisch sind oder die natürliche Artenvielfalt und das ökologische Gleichgewicht des Gewässers stören können.

Last but not least gehört eine laufende Erfolgskontrolle der gesetzten Maßnahmen dazu.
Weitere Informationen
Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. Kurt Pinter, Dissertation, Wien 2019, Ökosystem-basiertes fischereiliches Management in Fließgewässern.

wurde in erster Linie das Ausmaß der produzierten Eier herangezogen (orange). Wenn keine Eier produziert werden, dann wurde das Ausmaß der direkt vermarkteten Besatzfische herangezogen
(blau). Zehn Betriebsleiter gaben an gar keine oder keine Handelsbeziehungen zu anderen Betrieben
innerhalb des Untersuchungsgebietes zu halten (grau). Die Platzierung der Betriebe innerhalb der
Bundesländer ist zufällig gewählt. Handelsbeziehungen zu Betrieben außerhalb des Untersuchungsgebietes sind nicht dargestellt.
Emmanuel Milot, 2012, Reduzierte Fitness von in die Wildnis entlassenen Atlantischen Lachsen nach einer Generation der Zucht in Gefangenschaft
Wilder Populationen durch in Gefangenschaft gezüchtete Individuen ist eine gängige Praxis, insbesondere bei Lachsarten. Solche Praktiken werden jedoch allgemein kritisiert, da sie den Rückgang wilder Populationen nicht wirksam verhindern können und potenziell zum Rückgang beitragen können. Obwohl die Zuchtpraktiken in Gefangenschaft verbessert wurden, zum Beispiel durch die Freilassung von Jungtieren, die aus jährlich gefangenen lokalen Wildzuchttieren gezüchtet wurden, um die Domestizierung und den Verlust der lokalen Anpassung zu minimieren, besteht weiterhin ein signifikanter Rückgang der Fitness von in Brutstätten gezüchteten Fischen im Vergleich zu Wildfischen. Für erfolgreiche Management- und Artenschutzmaßnahmen ist es daher erforderlich, das Schicksal der in Brutstätten aufgezogenen und in die freie Wildbahn entlassenen Exemplare zu dokumentieren.


Den zweiten Teil der Dissertation bilden fünf weiterführende Publikationen, wovon vier in englischsprachigen SCI-Journalen erschienen sind; ein Artikel ist in einer österreichischen Fachzeitschrift
veröffentlicht.
Einer der schwerwiegendsten und besorgniserregendsten Verstöße gegen den erhalt unserer Wild-Fischpopulationen, ist das weitverbreitete Verirren und Besetzen von Zuchtfischen in unteren Gewässer. Dies geschieht, wenn in Zuchtbetrieben gezüchtete Fische, die als Lebensmittel bestimmt sind, in unsere Seen, Bäche und Flüsse ausgesetzt werden, wo sie sich mit Wildfischen vermehren. Wenn dies in einem Ausmaß geschieht, das das ein Maß überschreitet, untergraben Zuchtfische die Genetik der Wildfische. Zuchtfische (Speisefische), die sich mit Wildfischen vermehren, stellen erhebliche Herausforderungen für die Erholung unserer vom Aussterben bedrohten Wildfischpopulationen dar.

„Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen. Wer die Gegenwart nicht versteht, kann die Zukunft nicht gestalten..“