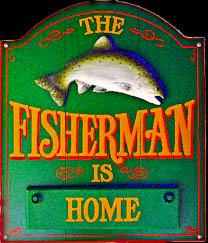Ein Thema, welches mich schon lange beschäftigt, wurde durch einen sehr interessanten Vortrag am ÖKF Forum 2020 gebracht. Es zahlt sich immer wieder aus, solche Kongresse zu besuchen. Neben „Networking“ mit wichtigen Personen aus der Szene, werden wichtige Themen vorgestellt und behandelt. Danke an den ÖKF für die Durchführung dieser Veranstaltung, die wir heuer, ganz knapp vor einer „Corona Event-Sperre“ noch besucht haben.

Gewässerpflegekonzepte – ein neues Planungsinstrument
Wie wir die Erwärmung der Gewässer bremsen könnten, das berichtete uns DI Josef Mader vom Amt der OÖ-Landesregierung, Gewässerbezirk Grieskirchen am ÖKF Forum in Linz, am 7. März 2020. Dazu stand am Beginn, eine Studie, die einen Anstieg der Temperatur in OÖ Fließgewässer um +2.84 Grad Celsius bis 2050 prognostiziert.

Um dem entgegenzusteuern stellte er Gewässerpflegekonzepte als ein neues Planungsinstrument vor. Darunter versteht man, jene Instandhaltungs-, Pflege und Betriebsmaßnahmen auszuwählen und festzulegen, mit denen die Wirksamkeit und Sicherstellung des Hochwasserschutzes, bei gleichzeitiger Erhaltung oder Verbesserung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer erreicht werden kann.

Vision der Fischerei


Das Gewässer hat einen mehrreihigen Ufersaum, eine ausreichende Pfufferfläche zu den diversen Nutzungen, hinsichtlich der chemischen und physikalischen Wasserqualität und der ökologischen Funktion einen sehr guten oder zumindest guten Zustand! Der Bodenwasserhaushalt im Umland
ist in Takt und wirkt für das Gewässer als Puffer.
Gewässer braucht Platz
Da wird es zumeist an vielen Stellen etwas Engen. Nach dem Motte „Allen Recht getan ist eine Kunst die keiner kann„, wurde im Vortrag von Hr. DI Josef Mader vom Gewässerbezirk Grieskirchen recht anschaulich auch diese Seite erklärt und Bewußtsein dafür geschaffen, dass in einer „Kulturlandschaft“ die Möglichkeiten beschränkt sein können, weil ein Risiko und das jeweilige Restrisiko hinsichtlich Hochwasser vorhanden ist, auf welches Rücksicht genommen werden muss.
Gewässerpflegekonzepte vom Gewässerbezirk
Dieses Bild veranschaulicht recht schön, dass Dilemma in dem unsere Gewässer um den Platz zwischen Straßen, Bahnlinien, Grundstücken, Felder, Gehwege und Hochwasserschutz etc. stehen.

…….um jene Instandhaltung –, Pflege und Betriebsmaßnahmen auszuwählen und festzulegen, mit denen die Wirksamkeit von Hochwasserschutzanlagen und die Sicherstellung eines bestehenden Hochwasserschutzes bei gleichzeitiger Erhaltung bzw. Verbesserung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Gewässer erreicht werden kann.

Quelle: Vortrag von DI Josef Mader vom Amt der OÖ-Landesregierung, Gewässerbezirk Grieskirchen

Quelle: Vortrag von DI Josef Mader vom Amt der OÖ-Landesregierung, Gewässerbezirk Grieskirchen
Mögliche Maßnahmen
Keine gänzliche Entfernung der Gehölze, so ist die Beschattung von Gewässer und Uferböschung weiterhin gegeben und verhindert eine zu starke Erwärmung. Auch das Aufkommen unerwünschter Arten (Invasive Neophyten, Wasserpflanzen, Algen) und zu starken Austrieb ist zu reduzieren. In Abschnitten, wo es keinen besonderen Schutzbedarf (Infrastrukturelemente) gibt, sollte Alt- und Totholz zumindest bereichsweise belassen werden. Verdeutlicht hat er dies anhand der Revitalisierung der Trattnach bei Grieskirchen und Schlüßlberg.

Zurück ins Fischereirevier Oberes Salzkammergut
Nach dem sehr interessanten Vortrag von Hr. DI Josef Mader vom Amt der OÖ-Landesregierung, Gewässerbezirk Grieskirchen ist klargeworden, dass wir mit der zerstörerischen Kraft und den Wassermassen der Traun und der Ischl eventuell mit größeren Kräften zu tun haben. Jedoch in der Zwischenzeit wurde viel für den Hochwasserschutz bei uns im Salzkammergut getan.

Es stellt sich allerdings die Frage, ob nicht Zuviel des Guten in Richtung Hochwasserschutz und Zuwenig in Richtung Renaturierung getan wurde. »Bei uns im Fischereirevier Oberes Salzkammergut wir unter dem Deckmantel „Renaturierung“ einige solcher Mogelpackungen die z.B. in den natürlichen Bewuchs der Uferzonen eingreifen und jeden Strauch niederholzen, sowie es sich halbwegs als Gewächs etablieren konnte. Oder es wurden ökologische Altarme geöffnet die mehr Fische pro Jahr ruinieren als natürlicher Bestand nachwachsen kann. Vertreter aus Fischerei, Bienenzucht und Jägerschaft zusammen stellen fest, dass es hier dringend Nacharbeiten und ein Umdenken erforderlich wären.

Dramatische Gewässererwärmung
Auf die »dramatische Gewässererwärmung« in einem heißen Sommer wie in diesem Jahr wurde vom Fischereirevier Oberes Salzkammergut mehrfach hingewiesen und durch Fischer werden jährlich, mehrfach einige tausend Fische aus den trockenlaufenden Altarmen gerettet. Auch brauchen wir mehr Beschattungsflächen an unseren Gewässern, etwa durch ufernahe Weiden, oder andere heimische Gehölze. Die wärmeempfindliche Bachforelle weicht bereits in Seitenbäche aus. Vorteilhaft seien Strukturen bestehend aus mittig im Gewässer eingebaute Steinschüttungen, abwechselnd mit tieferen Gumpen, Holzverbauungen mit Kehrwasser und Totholzbereiche, in denen die Fische Unterschlupf finden können. Hier sind wir leider noch in der falschen Zeit unterwegs.
Zu wenig Nahrung für Insekten

Zu kritisieren ist, dass durch die Beseitigung vieler Weiden mit ihren energiereichen Pollen am Damm gerade im Frühjahr das Nahrungsangebot für Bienen und Insekten massiv eingeschränkt worden sei. Die Blühstreifen entlang der Hauptstraßen würden aufgrund des für Bienen ungünstigen Fahrtwinds nur bedingt Ersatz bieten. Eine Ausweisung von Blühstreifen am Gewässerrand durch die Landwirte könnte Entlastung bieten. Ebenso Anlass zur Kritik gaben die frühen und häufigen Mähintervalle an den Dämmen durch die Gemeinden und den Gewässerbezirk, die das Absamen von Blühpflanzen verhindern und Bodenbrütern die Deckung nehmen und nur die Ausbreitung von invasiven Pflanzen förderlich sind, die sich durch fehlende heimische Gehölzstreifen immer mehr ausbreiten.
Interessen der Landwirte berücksichtigen
Die Forderungen der Imker, den Uferdämme naturnäher und bienenfreundlicher zu gestalten, halte diese ebenfalls für berechtigt und nachvollziehbar. Gleiches gelte für die Forderung der Fischer, Rückzugsräume für die verschiedenen Fischarten zu schaffen, die in den überhängenden Hölzern unterstand und Schutz vorfinden.

Kleine Fließgewässer können ihre Funktion nur dann erfüllen, wenn sie in einem ökologisch intakten, naturnahen Zustand sind. Ein naturnaher Zustand ist auch dadurch erreichbar, dass man nicht regulierend in ein Gewässer eingreift. Dazu gehört, die Ufervegetation sich selbst zu überlassen und nicht zurückzuschneiden, was sowohl Strukturen als auch Nahrung für Fische schafft.

Diese Strukturen erfüllen noch weitere, wichtige Funktionen. So tragen sie zum Hochwasserschutz bei und sorgen für saubere, kühle Gewässer und Grundwasser. Wird dem Gewässer genügend Raum in Form eines breiten Uferstreifens gegeben (Abbildung), kann sich die Ufervegetation optimal entfalten. Außerdem werden durch die Strömung auch Strukturen wie tiefe Außenkurven und flache Innenkurven geschaffen. Ein ungehinderter Geschiebetransport kann dann für weiteren Lebensraum sorgen. Diese Prozesse können mit einer gezielten Revitalisierung in Gang gebracht werden.

Sorgfältige Revitalisierungen zielen darauf ab, die natürliche Strömungsvielfalt, die Vernetzung und die lokale Biodiversität eines Gewässers wiederherzustellen. Zu bedenken ist, dass nach einer Revitalisierung immer eine Erfolgskontrolle durchgeführt werden sollte, um aus Erfolgen oder auch Fehlern zu lernen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Flora und Fauna mehrere Jahre (bei manchen Bäumen sogar Jahrzehnte) oder Generationen brauchen, bevor sie sich vollständig erholen können. Die Generationszeit der meisten Fische ist zum Glück um ein Vielfaches kürzer als diejenige von uns Menschen, dennoch benötigen Erholungsprozesse ihre Zeit und können Jahre in Anspruch nehmen.
Potentiale
Verbesserungs-Potentiale gibt es trotz aller negativer Entwicklungen etwa bei einer Reihe von Biotoptypen der Fließgewässer, unter anderem aufgrund der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), die eigentlich schon seit 2000 umgesetzt werde sollten. Man könnte die großen Maßnahmen um zig hunderttausende Euro zurückstellen und auf „kleiner Maßnahmen“ umsteigen, so wie die Öffnung von Uferverbauungen mit Wasserbausteine. Dann kann man die Natur arbeiten lassen und die Entwicklung abwarten, wie sich der Fluss und der Bach seinen Platz zurückerobert. Die freiwerden Flussbausteine könnte man für sauerstoffanreichernde Strukturen verwenden. D.h. mit ein paar „Bagger-Tage“ wäre viel zu erreichen.
Weitere Informationen
„Nachhaltige Entwicklung bedeutet: den Bedürfnissen heutiger Generationen zu entsprechen, ohne die Möglichkeit künftiger Generationen zu gefährden.“