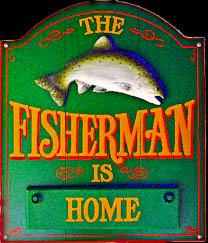Vom „Salzkammergut Fischereimanagement“, mit Obmann DI Karl Fehrer wurde der Traunkirchner Mühlbach gepachtet und wird seit heuer bewirtschaftet. Da dieser aufgrund von Verbauung und eines staken Prädatoren Druck, in einen fischereilich sehr schlechtem Zustand befindet, wird mit verschiedenen Methoden versucht die Bachforelle zu unterstützen, um wieder einen sich selbst reproduzierenden Fischbestand aufzubauen.

Fischereiliche Bewirtschaftung
Der Traunkirchner Mühlbach (TKM) ist ein ca. 5 km langer Bach in Oberösterreich und bildet die Gemeindegrenze zwischen Altmünster und Traunkirchen. Seinen Ursprung hat er im Gebiet von Windlegern. Der Mühlbach verläuft in nordöstlicher Richtung und mündet in den Traunsee. Der Traunkirchner Mühlbach (TKM) ist ein wichtiger Bestandteil des Ökosystems und beheimatet viele Tier- und Pflanzenarten. Vom Fischereimanagement Salzkammergut (FMSKG) wird er uns künftig als Aufzuchtgewässer für Bachforellen dienen.
Er ist von der Größe her das ideale Aufzuchtgewässer für Bachforellen und nachdem wir unmittelbar daneben auch unser Fisch Labor, eine kleine auf Wildfisch-Development ausgerichtete Fischzuchtanlage.
Fischereimanagement Salzkammergut
Das Fischereimanagement Salzkammergut legt großen Wert auf die Erhaltung und sinnvolle Bewirtschaftung von Fließgewässern. Ein zentrales Anliegen ist dabei die Förderung der „Wildkultur-Fisch-Entwicklung„. Seit 2019 betreibt das Fischereimanagement Salzkammergut ein Bruthaus zur Aufzucht und Entwicklung unserer heimischen Salmoniden.
Um die „Fischkultur-Fisch-Entwicklung“ weiter voranzutreiben, geht das Fischereimanagement Salzkammergut neue Wege und hat mit dem „FischLab-Mühlbach“ eine weitere Fischzuchtanlage und nun ergänzend, denn Traunkirchner Mühlbach (TKM) gepachtet, um diesen als Aufzuchtgewässer zu nutzen.


Die Erhaltung und sinnvolle Bewirtschaftung von Fließgewässern zählt unbestritten zu den zentralen Anliegen des Fischereimanagement Salzkammergut (FMSKG). Im Spannungsfeld einer sich rasch wandelnden Gesellschaft, zwischen Romantisierung und Kommerzialisierung eines nur vage definierten Naturbegriffes, findet sich heute der Gewässerbewirtschafter vermehrt mit Problemen konfrontiert, die eine entsprechende Kompetenz im Bereich ökologischer Zusammenhänge fordern. Unsere Aktivitäten sind auf die Erarbeitung von Grundlagen zur nachhaltigen Bewirtschaftung von wildlebenden Fischbeständen im Kontext der Angelfischerei in unseren Fließgewässern ausgerichtet. Wir versuchen Brücken zwischen der Fischereiökologie und den Fischen auch die Einstellungen und Verhaltensweisen der Angler und der Entscheidungsträger in Vereinen und Behörden mit zu berücksichtigen. Wir kooperieren mit vielfältigen, führenden Universitäten und Praxispartner. Diese umfassen Angelvereine, -verbände und die behördliche Verwaltung sowie dem zuständigen Verband für Fischereiwirtschaft und Aquakultur.

Bachforellen-Development
Zum einen werden Setzlinge – also noch kleine Bachforellen ausgesetzt, zum anderen werden Bachforelleneier per Cocooning in Plastikboxen im Traunkirchner Mühlbach (TKM) aufgestellt. Dabei werden Bachforelleneier im Gewässergrund vergraben, man imitiert sozusagen eine natürliche Laichgrube der Bachforelle. Die geschlüpften Larven wachsen dann von Anfang an in ihrer natürlichen Umgebung auf.

Cocooning mit Bachforellen

Cocooning – eine alternative Methode für ein ökologisch nachhaltiges Instrument für das Fischereimanagement. Der Schwerpunkt liegt dabei auf in der Anwendung neu entwickelter Fischzuchtkästen für das nachhaltige Management von Kieslaichfischen. Aktuell sind zwei solche Boxen, die mancher als Müll missinterpretieren könnte aufgestellt und dabei handelt es sich jedoch nur um temporäre Kinderstuben für Bachforellen. Es wird ersuche diese Boxen nicht zu berühren oder zu entfernen. Sie werden nach dem Schlupf der kleinen Bachforellen wieder aus dem Mühlbach entfernt werden. Diese Vorgangsweise hat das Ziel, dass wir eine natürliche Fischbestand aufbauen wollen, damit sich der Bachforellenbestand bald wieder natürlich vermehren kann.


Homing Effekt
Dem Prinzip des »homings« = Rückkehr zum Ort der Geburt folgend, können bei dieser Methode potenzielle Laichplätze ausgesucht, die Boxen dort exponiert und so möglicherweise neue Laichplätze, zu denen laichfähige Fische später zurückkommen können, initiiert werden. Dieser Aspekt erscheint uns im stark fragmentierten Gewässersystemen überlegenswert, da durch stake Kontinuums Unterbrechungen historische Laichgründe oft nicht mehr erreichbar sind und neue Laichplätze initiiert und in weiterer Folge auch gepflegt werden müssen.

Fischarten im TKM
Bachforelle
Die Bachforelle (Salmo trutta fario) ist ein zu den Salmoniden zählender Raubfisch und eine Unterart der Forellen. Sie ist der Leitfisch der Forellenregion und wird auch Flussforelle, Bergforelle oder Fario genannt. Kleinwüchsige Bachforellen in nahrungsarmen Gewässern werden als Steinforellen bezeichnet. Bachforellen werden je nach Nahrungsangebot 20 bis 80 Zentimeter lang, in Ausnahmefällen sind Größen von einem Meter und Gewichte über 15 Kilogramm möglich. Ihr Rücken ist oliv-schwarzbraun und silbrig blau, bauchwärts treten rote Flecken mit hellem Rand auf, die Bauchseite ist weißgelb. Die Bachforelle erreicht in der Regel ein Gewicht von bis zu zwei Kilogramm. Bachforellen können bis zu 18 Jahre alt werden.

Die Bachforelle bevorzugt kühle und sauerstoffreiche Bäche wie den Traunkirchner Mühlbach. Diese sind sehr standortstreue Fische, die ihren Platz nur zur Fortpflanzung verlassen und auch nach Störungen in der Regel an ihre angestammten Plätze zurückkehren. Die Bachforelle benötigt zahlreiche Unterstandsmöglichkeiten, wie grob gelagerte Felsblöcke, Wurzelstöcke, Totholzbereiche um sich zu verstecken und zu schützen. Natürlich reproduzierende Bestände ursprünglicher Bachforellen sind heute meist nur mehr in selten zu finden. Mit den gesetzten Maßnahmen soll der Bestand wieder aufgebaut werden.
Koppe – Mühlkoppe

Die Koppe oder Groppe (Cottus gobio), auch Kaulkopf, Rotzkopf, Westgroppe, Mühlkoppe, Dickkopf oder Dolm genannt. Die Koppe ist ein nachtaktiver Grundfisch mit spindelartigem Körper, einem großen, breiten Kopf (beim Männchen breiter, beim Weibchen spitzer), glatter, schuppenloser Haut und zurückgebildeter Schwimmblase, der etwa 12 bis 16 cm lang wird. Ihre Bauchflossen sind brustständig.
Bachschmerle
Die Bachschmerle (Barbatula barbatula, Syn.: Noemacheilus barbatulus), oft auch kurz Schmerle oder Bartgrundel genannt, ist ein europäischer Fisch. Er wurde bis etwa 1980 in die Familie Cobitidae gestellt – dann kam man zu der Erkenntnis, dass er näher mit den Balitoridae verwandt sein müsse, die in Europa sonst nicht vorkommen. Die Bachschmerle ist ein Bodenfisch. Der Körper weist eine rundliche Form und eine hellgraue Farbe mit leicht dunkleren Flecken auf. Sie besitzt sehr kleine Schuppen oder ist schuppenlos, hat dafür aber eine dicke Schleimhaut, über die sie wie der Schlammpeitzger auch einen Teil des Sauerstoffbedarfs decken kann. Sie verfügt ebenfalls über die Fähigkeit der Darmatmung. Am Maul besitzt sie 6 Barteln. Ihre Körpergröße liegt zwischen 8 und 12 cm, maximal 18 cm. Die Laichzeit erstreckt sich von März bis Juni.
Elritze
Die Elritze (Phoxinus phoxinus), auch Bitterfisch, Maipiere oder Pfrille genannt, ist ein Kleinfisch aus der Familie der Karpfenfische (Cyprinidae), der im Süßwasser lebt. Elritzen werden 6 bis 8 cm lang, selten bis 12 cm. Die Fische sind gelb-bräunlich gefärbt und besitzen kleine Schuppen. Ihre Seiten sind mit braunen und schwarzen Tupfen oder Streifen bedeckt. Der Bauch ist weiß bis rötlichweiß, zur Laichzeit bekommen die Männchen eine rote Unterseite. Beide Geschlechter bilden Laichausschlag aus.
Fischbuch Nr. 21/59
Das Fischereibuch stellt eine Sammlung von Daten über Fischwässer, über Fischereirechte und Fischereiberechtigungen sowie Pächterinnen oder Pächter und Verwalterinnen und Verwalter im jeweiligen Verwaltungsbezirk dar. Das Fischereibuch besteht aus dem Hauptbuch (A- und B-Blatt), der Urkundensammlung und dem Verzeichnis der Fischereiberechtigten.


https://huberpower.com/wordpress/?page_id=14494
Wasserführung
Die Wasserführung des Traunkirchner Mühlbaches wird im WR-Bescheid Wo-2057/3-1963/Br, Amt der OÖ. Landesregierung vom 9. August 1963 betreffenden der seinerzeitig verhandelten Wasserversorgungsanlage; sowie lt. Bescheid vom 19.2.1955, Wa-149/3-1954 des hydrologischer Dienst der OÖ. Landesregierung bei Niedrigwasser bei der Brunnermühle mit 45 l/s und als Mittelwasser mit 300 l/s angegeben.
Mündungsbereich in den Traunsee
Der Traunkirchner Mühlbach wird vom Traunsee im Mündungsbereich eingestaut, und schon
nach etwa 60 m von der Mündung befindet sich ein unpassierbares Wehr. Die Sohle ist locker
kiesig, die Ufer sind anthropogen über prägt und steil, die Wassertiefe beträgt etwa 0,5 – 0,75m
bei geringer Strömung.

Quelle: ezb – TB Zauner, Erhebung essentieller Habitate für die Fischfauna des Traunsees – Gewässerbereiche mit besonderer ökologischer Funktion. Dezember 2023
Zubringer stellen für einige Arten des Traunsees obligatorische Laichhabitate dar (z.B. Seeforelle, Rußnase), von einer Reihe weiterer Fischarten werden Zubringer fakultativ genutzt (z.B. Seelaube, Perlfisch, Koppe). Bei einigen Arten stellt eine Ausstrahlwirkung von Zubringern in den See eine wichtige Voraussetzung für ein Vorkommen dar (z.B. Koppe, Bachschmerle, Elritze). Insgesamt ist für 8 der 15 Fischarten eine sehr hohe fischökologische Bedeutung von Zubringern abzuleiten.

Quelle: ezb – TB Zauner, Erhebung essentieller Habitate für die Fischfauna des Traunsees – Gewässerbereiche mit besonderer ökologischer Funktion. Dezember 2023

Quelle: ezb – TB Zauner, Erhebung essentieller Habitate für die Fischfauna des Traunsees – Gewässerbereiche mit besonderer ökologischer Funktion. Dezember 2023
Der Traunkirchner Mühlbach (TKM) hat durchaus mit seinem kiesigem Schwammkegel eine besonders hohe fischökologische Bedeutung für kieslaichende Arten wie Seeforelle, Seelaube, Elritze, Aitel. Diese weisen aufgrund der günstigen Vernetzung von Flachwasserbereichen und Zubringern prinzipiell eine spezielle Qualität auf. Die Form dieser Schwemmkegel weicht in der Lage und im Querschnitt von breiten Flachwasserbereichen ab. Dort wird einerseits durch den laufenden Geschiebeeintrag und andererseits durch die Dynamik sowohl durch Hochwässer des Zubringers als auch durch See-Strömungen eine günstige Sedimentverteilung gefördert. Überdeckung durch Feinsedimente spielt hier eine wesentlich
geringere Rolle. Leider ist gleich unmittelbar nach der Mündung in den Traunsee eine für viele Fischarten unüberwindbares Querbauwerk eingebaut.
Weitere Informationen
Hier möchte ich unser neues Projekt vorstellen, das „Fischzucht Labor – Mühlbachtal“ kurz „FischLab Mühlbachtal“ (MBT). Diese Fischzuchtanlage sichert unsere Bedarfe und unser Engagement um die Erhaltung unserer heimischen Fischarten. Wir wollen damit für unsere Bewirtschafter im „Fischereirevier Oberes Salzkammergut“, ein Knotenpunkt sein – ein Zentrum für heimische Besatzfische, aus dem Einzugsgebiet der Oberen Traun. Im Vorstands-Team vom „Fischereimanagement Salzkammergut“ leisten wir dazu die Feldarbeit, die erforderlich ist um Elterntiere, rechtzeitig zur Laichzeit abzufischen und abzustreifen und mit dem „FischLab Mühlbachtal“ (MBT) haben wir die technischen Voraussetzungen um Salmoniden Eier für Cocooning und Brütlinge als Besatzfische für unser Traun-Einzugsgebiete effizient zu entwickeln.

„Dort wo eine Quelle entspringt oder das Wasser fließt, dort sollten wir „Wildkultur-Fische“ den Lebensraum erhalten und ihre Bestand fördern.“ abgewandeltes Zitat, von Lucius Seneca, römischer Naturforscher – um 1-65 n.Chr.